Vom Herausgeber des neuen „ großen österreichischen Kommersbuches" Kbr. Prof. Raimund Lang v. Dr.cer. Giselher (ILH et mult.).
Dass der studentische Gesang so alt ist wie die studentischen Gemeinschaften, kann als sicher an-genommen werden. Musikalische Artikulation ist die älteste kultische Äußerung der Menschheit, und so haben schon die frühen Studenten, die von weither zu den wenigen Hohen Schulen gezogen sind und sich dort in Wohngemeinschaften zusammengeschlossen haben, zum Schmaus und Trunk gewiss auch den Gesang gepflogen.
Ein Kuriosum ist freilich, dass das erste Lied, dem wir heute das Prädikat Studentenlied zugeste-hen, während eines Krieges entstanden ist. Es geschah während des lombardischen Feldzugs Friedrich Barbarossas im Jahr 1164, dass der – für uns namenlos gebliebene, aber als „Archipoeta“ überlieferte – Hofdichter des Kölner Erzbischofs und deutschen Reichskanzlers Reinald von Dassel sich vor seinem Herrn gegen den Vorwurf des Trunkes verteidigen musste und dies mit geschliffenen lateinischen Versen tat, deren mittlere Strophen, beginnend mit den Worten „Meum est propositum in taberna mori“, durch die spätere studentische Rezeption zum ersten Produkt der „Kneippoesie“ wurden.

Was der Archipoet – der Erzdichter also – kreierte, war zwar ein Lob des Trinkens, aber frei von jeglicher Saufattitüde, wie sie die Studentenlieder des Hochmittelalters bis hinein ins 19. Jh. kennzeichnet. Denn seine, schon bei Horaz und Anakreon vorgedachte, später von den orientalischen Dichtern wie Omar Chajam oder Hafis weitergeführte und über sie von Goethe übernommene Philosophie preist den erbaulichen und belebenden Trunk, der zur Öffnung des Geistes, Hebung des Bewusstseins und Anregung der Phantasie dient. Diese Art des Stoffgenusses ist ein kontrollierter und damit gemeinschaftsfördernder Vorgang, der bis heute jeglichem studentischen Kneipen als Muster dienen kann.
Am Anfang steht folglich nicht nur ein Trinklied, sondern auch ein lateinisches Gedicht, also humanistisches Bildungsgut. Als solches hat sich bis heute nur das wesentlich jüngere, über Jahrhunderte lange Mutationen entstandene „Gaudeamus igitur“ in unserem Repertoire gehalten. Aus einem düsteren Bußlied hat es sich zu etwas entwickelt, das eher an Flagellantenprozessionen denken ließ als an studentische Festzüge. Aber letztlich siegte die Lebenslust über die Beklagung der Vergänglichkeit – das Wort Gaudeamus – Freuen wir uns! – trat an die Spitze und kennzeichnet bis heute die Grundstimmung geselligen studentischen Selbstverständnisses.
Der es uns aufgeschrieben hat, war ein eher zügelloser und verbummelter Magister aus Halle, Christian Wilhelm Kindleben, dem wir aber immerhin das erste gedruckte Studentenliederbuch der Welt verdanken. Für dieses hat er dem Gaudeamus seine bis heute gültige Textgestalt gegeben. Das war 1781, und nur ein Jahr später folgte der Norddeutsche August Heinrich Niemann mit seinem „Akademischen Liederbuch“, worin sich der „Landesvater“ mit all seinen wechselnden Strophenformen findet, wie wir ihn – mit einigen Abstrichen und Variationen – heute noch singen.
Bis ins späte 18. Jh. haben sich studentische Lieder – also Lieder, die entweder von Studenten oder für Studenten geschrieben wurden, oder den Studenten zur handelnden Figur erhoben – nur durch handschriftliche Überlieferungen verbreitet und erhalten. Ihre Themen waren neben dem Trunk natürlich die Frauen und der verkürzend als „Liebe“ überschriebene Kontakt zu ihnen, das Glückspiel und das Raufen, wobei das eine oft genug mit dem anderen zu tun hatte. Unter Raufen ist der Kampf mit der der scharfen Hieb- oder Stichwaffe zu verstehen, die zu führen die Studenten schon früh beansprucht hatten, was zur Rohheit des studentischen Lebens einiges beigetragen hat.
Diese Roheit war für die Sitten der beschönigend als „Musensöhne“ bezeichneten jungen Herren und ihrer Zirkel durchaus charakteristisch und wurde von der Bevölkerung verabscheut und gefürchtet. Entsprechend derb und zotig fielen auch die Lieder aus, deren Niederschriften nicht selten durch diskrete Pünktchen neutralisiert wurden. Selbst manche alte Gaudeamus-Strophen entbehren nicht solcher Schlüpfrigkeit.
Daneben aber haben sich durchaus rührende und ethisch ansprechende Texte entwickelt und erhalten, die uns in mehren Sammlungen vorliegen, etwa dem „Studentenschmaus“ des Johann Hermann Schein von 1626, dem noch älteren „Studentengärtlein“ des Johannes Jeep (frühes 17. Jh. oder dem Liederbuch des Leipziger Studenten Clodius von 1669).

Erst die studentischen Orden des 18. Jh., die teils gegen die bestehenden Verbindungen, teils auch innerhalb dieser entstanden sind, brachten eine Art von Sittlichkeit und Kultur in das studentische Bundeswesen, und schließlich sorgte der napoleonische Schock für eine völlige Neuorientierung. Studenten begannen, ihren gesellschaftlichen und politischen Auftrag zu begreifen und eilten unter dem Eindruck des Freiheitsverlustes – der sich ja auch auf den unter französische Verwaltung geratenen Universitäten auswirkte – zu den Fahnen und Waffen. Damit änderte sich die studentische Gesangstradition radikal. Das Kampflied trat auf, glutvoll und aufputschend, voller Kraft und Begeisterung. Arndt, Schenkendorff und der todessehnsüchtige Körner sind seine Exponenten, unter den Komponisten nimmt Methfessel eine führende Stellung ein.
Dass uns gerade diese Lieder, die vom fatalistischen Erlebnis eines als unvermeidbar empfundenen, letztlich auch erfolgreichen Krieges geprägt sind, heute Schwierigkeiten machen, ist klar. Gar manches ist in der Gegenwart unsingbar geworden, aber der Rang dieser Lyrik und ihrer musikalischen Entsprechung (immerhin gehört Carl Maria von Weber zu deren Meistern) ist deshalb nicht verwerflich, sondern bedarf des Zeitverständnisses.
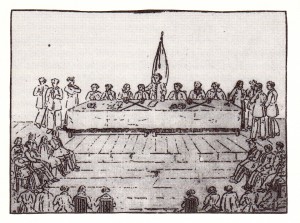
Die Urburschenschaft (1815) mit ihren hohen Idealen wuchs aus dieser Bewegung heraus und wurde zur ersten Korporation des modernen Typs. Gerade sie pflegte das studentische Lied zum Zweck der emotionellen Bindung – so war mit der Einladung zum Wartburgfest (1817) auch die Aufforderung an jede Delegation verbunden, ein neues Lied zu verfassen und mitzubringen, was auch geschah. Es ist also kein Zufall, dass viele Trinklieder jener Zeit auch Kampflieder sind und umgekehrt. Und noch etwas tritt durch die Urburschenschaft hinzu: das Gottesbild. „Wem soll der erste Wunsch ertönen? Dem Gott, der groß und wunderbar“ klingt es schon beim Gründungsakt, und bei der erzwungenen Auflösung vier Jahre später heißt es: „Der Geist lebt in uns allen, und unsre Burg ist Gott!“

Das studentische Lied entspricht während des 19. Jh. in seiner Entwicklung dem politischen Geschehen. Da folgt Revolutionäres auf Biedermeierliches, steht Parodie neben Bekenntnis. Da wird nach Ehre, Freiheit und Vaterland gerufen und gleichzeitig vom Schwarzen Walfisch zu Askalon erzählt. Dieser ist übrigens ein Produkt Josef Viktor von Scheffels, ohne dessen burschikosen Humor unsere Kneiptafeln noch heute ärmer wären (Ichthyosaurus, Hering und Auster, Zwerg Perkêo). Und musikalisch klingt das Jahrhundert mit den Weisen des Rheinländers Otto Lob aus, be-schwingt und melodienselig. Das 1907 gedichtete und von ihm vertonte „Student sein, wenn die Veilchen blühen“ wird zum letzten überregional erfolgreichen Studentenlied korporativer Prägung.
Das 20. Jh. bleibt epigonal. Zwar wird manch Neues gedichtet, doch ähnelt es dem bereits Vorhan-denen, was zumeist das Bessere ist. Ein wirklicher Stilwandel kam nicht mehr zustande. Stellt man heute ein Studentenliederbuch zusammen, wie der MKV das jüngst wieder getan hat, so ordnet man vor allem historisches Gut.
Was dieses neue Liederbuch, das sich stolz „Großes österreichisches Kommersbuch“ nennt, anbelangt, so war es durchaus Wunsch der Autoren, neben der Auswahl des Geläufigen und der verhaltenen Bereicherung durch Erneuertes auch die geschichtliche Entwicklung des Studentenliedes während der letzten beiden Jahrhunderte darzustellen und in vielen Fällen zu kommentieren und zu interpretieren. Ein heutiges Kommersbuch muss – das ist meine feste Überzeugung – auch „Leselieder“ enthalten, also solche, die unabdingbar zur Geschichte gehören, auch wenn sie sich nicht mehr als gegenwärtig singbar erweisen. „Der Gott, der Eisen wachsen ließ“ ist so ein typisches Beispiel – dass es auf ihn eine gelungene Parodie aus jüngster Zeit gibt, machte den Autoren mittels Gegenüberstellung die Aufnahme leichter.
Studentischer Gesang ist neben dem Tragen der Farben und dem Pflegen gewisser Rituale immer noch ein Kerngut der studentischen Gemeinschaften, das preiszugeben einer Aufgabe eigener Identität gleichkäme. Der Verband legt freilich das Liedgut für seine Mitgliedsverbindungen nicht fest, wie das gelegentlich erwartet wird. Er bietet nur eine Summe, aus der gewählt werden mag. Diese Auswahl ist und bleibt Sache der Korporation und damit ein Maßstab ihres Anspruchs und ihres Geschmacks.

